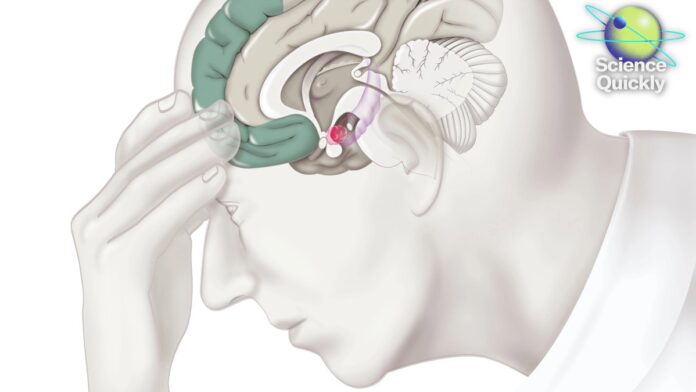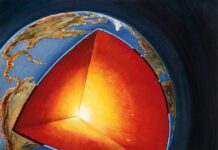Jahrzehntelang diente das Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) als Grundlagentext für die Psychiatrie und schreibt vor, wie psychische Erkrankungen kategorisiert, diagnostiziert und behandelt werden. Doch diese lange gehaltene „Bibel“ der psychischen Gesundheit steht vor einer kritischen Neubewertung. Die American Psychiatric Association (APA) erwägt weitreichende Änderungen, die die Art und Weise, wie psychische Störungen verstanden und behandelt werden, grundlegend verändern könnten.
Die Ursprünge des DSM liegen in einem Versuch Mitte des 20. Jahrhunderts, die psychiatrische Terminologie zu standardisieren. Bis 1980, mit der Veröffentlichung des DSM-III, war die Zahl der anerkannten Erkrankungen auf fast 300 angestiegen. Diese Erweiterung festigte die Rolle des DSM als führende Kraft in der klinischen Praxis, in der Forschung und sogar bei der Versicherungsabrechnung. Allerdings wird das Handbuch seit langem wegen seiner mangelnden wissenschaftlichen Genauigkeit kritisiert, und einige argumentieren, dass seine Kategorien nicht mit der zugrunde liegenden biologischen Realität übereinstimmen.
Die vorgeschlagenen Änderungen zielen darauf ab, diese seit langem bestehenden Probleme anzugehen. Das Kernproblem besteht darin, dass die aktuelle Struktur des DSM auf unterschiedlichen Kategorien beruht – schwere depressive Störung, bipolare I-Störung, posttraumatische Belastungsstörung –, während Neurowissenschaften und Genetik zunehmend darauf hinweisen, dass diese Grenzen künstlich sind. Während Diagnosen zuverlässig sein können (mehrere Ärzte sind sich oft darüber einig), sind sie möglicherweise nicht gültig (was die tatsächlichen zugrunde liegenden biologischen Unterschiede widerspiegelt).
Die von der APA vorgeschlagene Überarbeitung sieht vor, Ärzten eine größere Flexibilität bei der Diagnose zu ermöglichen. Anstatt eine starre Bezeichnung zu erzwingen, könnten Ärzte einen Patienten als „depressiv“ beschreiben, ohne den genauen Subtyp anzugeben. Dies könnte die „Wäscheliste“ der Diagnosen reduzieren, die Patienten manchmal erhalten und die möglicherweise nicht immer korrekt sind. Die Überarbeitungen würden Ärzte auch dazu ermutigen, Kontextfaktoren – wie Obdachlosigkeit oder zugrunde liegende Erkrankungen – in die Beurteilungen einzubeziehen.
Die vielleicht ehrgeizigste Idee ist die Einbeziehung von Biomarkern: Bluttests oder Gehirnscans, die theoretisch die physische Grundlage einer psychischen Erkrankung aufdecken könnten. Dies bleibt jedoch weitgehend theoretisch, da für die meisten Erkrankungen derzeit zuverlässige Biomarker fehlen. Die einzige Ausnahme bildet die Alzheimer-Krankheit, die an der Grenze zwischen Psychiatrie und Neurologie liegt.
Experten bleiben skeptisch. Kritiker argumentieren, dass das Herumbasteln an der Struktur des DSM das grundlegende Problem nicht lösen wird: seine Abhängigkeit von subjektiven Symptomen und nicht von objektiven biologischen Markern. Die Kluft zwischen dem klinischen Erscheinungsbild und der zugrunde liegenden Biologie ist nach wie vor groß, und die Hoffnung, eindeutige genetische oder neuronale Signaturen für bestimmte Erkrankungen zu identifizieren, hat sich nicht erfüllt.
Das DSM dient zwei Hauptzwecken: klinischer Behandlung und wissenschaftlicher Forschung. Während sich Forscher zunehmend von starren Diagnosekategorien entfernen und sich auf breitere Symptomcluster konzentrieren, benötigen Kliniker immer noch ein System für Diagnose, Abrechnung und effektive Patientenversorgung.
Trotz der Kritik ist die Demontage des DSM keine praktikable Option. Das System ist zu tief in die Gesundheitsinfrastruktur eingebettet. Das Ziel besteht nun darin, ein Gleichgewicht zwischen wissenschaftlicher Gültigkeit und praktischem Nutzen zu finden. Eine Aufgabe, die es erfordert, die Grenzen des aktuellen Wissens anzuerkennen und gleichzeitig den Diagnoseprozess weiter zu verfeinern.
Letztendlich liegt die Zukunft der Diagnose psychischer Erkrankungen darin, die Lücke zwischen subjektiver Erfahrung und objektiver Realität zu schließen. Diese Herausforderung erfordert kontinuierliche Forschung, kritische Bewertung und die Bereitschaft, sich an die Weiterentwicklung unseres Verständnisses des Gehirns anzupassen.